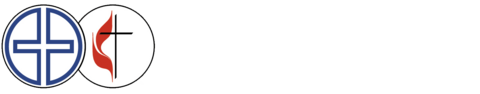Wenn aus einem Abgangs- ein Ankunftsland wird

EMK-Pfarrer Freddy Nzambe hilft jenen, die ankommen, die weiter wollen und die bleiben muessen
Die extreme Unsicherheit in Libyen drängt viele Migranten aus südlich der Sahara gelegenen Ländern nach Tunesien. Europa sähe es gerne, wenn diese Menschen in Tunesien blieben und gar nicht erst versuchten, mit Booten das Mittelmeer zu überqueren. Die Umsetzung einer europäischen Agenda gehört jedoch nicht unbedingt zu den Prioritäten Tunesiens.
Sie sind mit grossen Erwartungen nordwärts gezogen. Mit der Hoffnung auf ein Studium, das neue Perspektiven eröffnen würde. Oder einfach mit der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Für viele wird Tunesien jedoch zum Land der unerfüllten Pläne: sie arbeiten als Hilfsarbeiter auf dem Bau oder in einem Restaurant und verdienen vielleicht 6 oder 7 Euro pro Tag. Oft leben sie ohne legalen Wohnsitz gemeinsam mit anderen auf engem Raum, Paare und alleinstehende Männer, Muslime und Christen. Immerhin: Das Zusammenleben macht die Last der Mietkosten und des Lebens erträglich. Und letztlich ist die Situation in Tunesien trotz der niedrigen Löhne immer noch besser als im eigenen Land, wo Krieg herrscht oder zumindest der Frieden nicht blüht.
Viele wollen weiter nach Europa. Zwar gibt es schon jene, die auf die gefährliche Überfahrt nach Italien verzichten, nachdem Freunde ihr Leben im Mittelmeer verloren haben. Die Mehrheit versucht aber nach wie vor, genügend Geld zu verdienen, um die Schlepper bezahlen zu können. «Wenn von hundert Menschen zehn sterben, bedeutet dies, dass es neunzig schaffen, und dass sich der Versuch somit lohnt», sagt Eric, ein junger Mann aus Côte d’Ivoire, lakonisch.
Die erste Welle von Migranten aus Ländern südlich der Sahara – hauptsächlich Studierende – kam zwischen 1970 und 1980 nach Tunesien, und die Gründung von privaten Gymnasien und Universitäten zog später ebenfalls eine grosse Zahl ausländischer Studierender an. Das Problem besteht allerdings darin, dass viele in Tunesien erworbene Diplome im Herkunftsland kaum einen Nutzen haben, während ein Abschluss an einer europäischen Universität viel mehr wert ist. Es ist deshalb wenig überraschend, dass die Migranten nicht in ihre Heimat zurückkehren. Auch Touré Balamassi, ehemaliger Präsident der Vereinigung afrikanischer Studenten und Auszubildender in Tunesien und Mitbegründer der Vereinigung für Führung und Entwicklung Afrikas, kam vor 14 Jahren als Student aus Côte d’Ivoire und ist nie in seine Heimat zurückgekehrt. «Tunesien, das seit jeher als Land der Abreise gilt, ist zu einem Ankunftsland der Bevölkerung südlich der Sahara geworden, entgegen allen Widrigkeiten. Aber irgendwie wollte es das Land so.»
Die grösste Gruppe von Ausländern besteht aber nicht aus Studierenden oder aus Mitarbeitenden der 2003 angesiedelten Afrikanischen Entwicklungsbank, sondern aus Libyern. Es dürften wohl bis zu 200‘000 Menschen sein, die nach dem Fall von Gadaffi im Jahr 2011 aus Libyen flohen, ihres «Wohlstands» wegen jedoch als Expats und nicht als Flüchtlinge gelten. Weil in Tunesien ein zeitgemässes Migrationsgesetz fehlt, das an die Möglichkeiten des Landes angepasst ist, geraten die Libyer oft in eine ähnliche illegale Situation wie Menschen anderer Nationalitäten.
Freddy Nzambe, Pfarrer der Evangelisch-methodistischen Kirche, erlebt die Migrationsproblematik in seinem Dienst in der Reformierten Kirche von Tunis hautnah mit. Er weiss nicht nur um jene, die im Geheimen die Überfahrt nach Italien wagen, um in Europa einen Studienplatz, Arbeit, eine Zukunft zu finden – und die dort keine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Er kennt auch die Tragik des Menschenhandels, der in Tunesien blüht. Agenturen in Ländern südlich der Sahara machen grosse Versprechungen bezüglich eines Studienplatzes oder einer Arbeit als Haushaltshilfe. Potenziellen Haushaltshilfen wird gar der Flug nach Tunis finanziert. «Dann jedoch wird den jungen Frauen der Pass abgenommen, bis sie die Reisekosten bezahlt haben – und das kann zwei oder drei Jahre dauern», so Freddy Nzambe. In der Zwischenzeit leben die Haushaltshilfen in der Illegalität und sind ständiger Angst, Bedrohung und Ausbeutung ausgesetzt. Auch die Studierenden erfahren rasch, dass sie viel Geld für nichts bezahlt haben und schon nach wenigen Monaten in grossen Schwierigkeiten stecken.
Immer wieder erleben Migranten aus Ländern südlich der Sahara und aus Libyen auch Rassismus – manchmal verbal, manchmal sogar in Form von schwerer körperlicher Gewalt. Nach langen Jahren der Vorbereitungen wurde am 9. Oktober 2018 ein Gesetz gegen Anstiftung zu Hass und Diskriminierung verabschiedet. Der Wert dieses Gesetzes wird sich allerdings erst in dessen tatsächlicher Anwendung zeigen.
Tunesien hat in den letzten Monaten die Aufmerksamkeit europäischer Entscheidungsträger auf sich gezogen. Es wurde vorgeschlagen, in Ländern südlich des Mittelmeers sogenannte regionale Landeplätze einzurichten. Tunesien hat jedoch bereits darauf hingewiesen, dass es damit nicht einverstanden ist. «Zu Recht», sagt Touré Balamassi, der regelmässige Kontakte zu internationalen Organisationen und europäischen Politikern hat. «Europa möchte Sortierzentren in Ländern wie Tunesien und Marokko einrichten, damit sie auswählen können, wer kommen darf und wer nicht, wen sie brauchen und wen nicht. Das ist nicht fair.»
Massoud Romdhani, Vorsitzender des Tunesischen Forums für wirtschaftliche und soziale Rechte, ergänzt: «Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen daran zu hindern, nach Europa zu gelangen. Wir haben gute Beziehungen zu afrikanischen Ländern, und diese Zentren werden das Problem nicht lösen. Denn die ‚schlechte Nachricht‘ ist, dass die Migration nicht aufhört.» Tunesien möchte deshalb heutige und künftige Freihandelsabkommen mit der EU mit der Migrationsfrage verknüpfen. Massoud Romdhani sagt dazu: «Wir plädieren nicht für offene Grenzen. Wir plädieren für mehr Flexibilität bei der Erteilung von Visa. Letztendlich haben junge Menschen das Recht, Arbeit zu suchen. Sie haben auch ein Recht auf Enttäuschung.»
Was bedeutet es, für Ankommende, Weiterziehende und Bleibende, für Hoffnungsvolle und Enttäuschte Kirche zu sein, tragfähige Gemeinschaft zu gestalten, Glauben zu teilen, Not zu lindern? Auch der EMK-Pfarrer Freddy Nzambe und die Menschen seiner Gemeinde versuchen immer wieder neu, eine Antwort auf diese herausfordernde Frage zu finden.
Quelle: Samira Bendadi, Mondiaal Nieuws / Sekretariat des Bischofs Patrick Streiff, Zürich